Im Gespräch mit Sebastian Drescher.
Das Autofahren ist für viele Menschen eine Notlösung, sagt Katja Diehl. Um davon loszukommen, benötigen wir eine Verkehrswende, die wirklich alle mitnimmt.
Katja Diehl hat ein aufreibendes Jahr hinter sich. Im Februar erschien ihr Buch «Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt», in dem sie Lösungen für eine faire, klimafreundliche und inklusive Mobilität skizziert. Diehl kommt aus der Branche, war mehrere Jahre als Mobilitätsexpertin für Verkehrsunternehmen tätig. Nun versucht sie, von außen – als Autorin und unabhängige Beraterin für Politik und Unternehmen – eine umfassende Verkehrswende anzustoßen. Ihr Ansatz: Verstehen, warum der private Pkw noch immer unersetzlich scheint – und Wege aus der Autoabhängigkeit aufzeigen.
Diehl trifft mit ihrem Buch einen wunden Punkt. Nach seinem Erscheinen folgen Dutzende Interviews und Lesereisen, auf denen sie per Zug und elektrischem Faltrad durchs Land tingelt. Die Autorin erntet viel Zuspruch, aber auch harsche Gegenrede. Auf Twitter wird Diehl für ihre meinungsstarken Beiträge beleidigt und bedroht. Die einen sehen in ihr die «Autohasserin», die anderen kritisieren ihre Nähe zur Industrie. Von Twitter hat sich Diehl mittlerweile fast komplett zurückgezogen – erschöpft von der aufgeladenen Debatte und einer Verkehrspolitik, die auch in diesem Jahr kein Stück vorangekommen ist. Nichtsdestotrotz stellt sie sich Ende November im Interview gut gelaunt den Fragen des Energiewendemagazins.
Die Aktivisten der «Letzten Generation», die sich in Berlin und anderen Städten auf die Straßen kleben, sorgten zuletzt für viel Kritik. Frau Diehl, Sie zeigen sich solidarisch mit der Bewegung. Trifft der gegen das Autofahren gerichtete Protest die Richtigen?
Ich glaube nicht, dass die Aktionen jemanden Bestimmten treffen sollen. Ich sehe den Protest eher als ein Auf-die-Bremse-Treten, ein Aufbrechen der Normalitätssimulation. Mich hat besonders die Skandalisierung geärgert, etwa die Falschinformationen, die im Fall der Radfahrerin kursierten, die in Berlin von einem Betonmischer erfasst wurde und an den Verletzungen gestorben ist …
… wobei sich schnell herausstellte, dass das Rettungsfahrzeug, das durch eine Straßenblockade der «Letzten Generation» aufgehalten wurde, wohl ohnehin zu spät am Unfallort eingetroffen wäre.
Ja. Nach dem Fall Ende Oktober gab es zwei weitere tödliche Fahrradunfälle in Berlin, von denen man kaum etwas erfahren hat, weil sie sich nicht instrumentalisieren ließen. Was mich total entsetzt, sind die Bilder von Autofahrenden, die aussteigen und jungen Frauen, die die Straße blockieren, ins Gesicht schlagen. Als ob der Mensch im Auto ein Recht dazu habe. Unglaublich!
Welche Normalität brechen die Proteste auf?
Die Affekthandlungen im Hinblick auf die «Letzte Generation» zeigen: Wir wollen lieber verdrängen als uns der Realität stellen. Trotz aller Fakten wird immer noch verleugnet oder kleingeredet, wie ernst die Klimakatastrophe auch für uns in Deutschland werden kann. Dieser Verdrängungsmechanismus zeigt sich auch beim Komplettversagen des Verkehrsministeriums bei der Umsetzung der Klimaschutzziele und einem Bundesverkehrsminister, der 400.000 neue Autos zusätzlich im Jahr 2021 als Erfolg und nicht als Misserfolg von Verkehrspolitik sieht.

Für manche ist das Auto immer noch das Sinnbild für Freiheit. Wie wichtig sind solche emotionalen Aspekte in der Debatte?
Wenn ich über Autos rede, muss ich faktentreu argumentieren. Mein Gegenüber, das Pkws gut findet, denkt aber nicht in Mobilität, sondern in allem anderen. Das zeigt sich schon alleine daran, wie wir mit geparkten Autos umgehen. Die haben keinerlei Funktion, im Gegenteil: Sie rauben Raum, sie sorgen für Versiegelung. Eine wirkliche Funktion haben Autos nur einen Bruchteil der Zeit, nämlich in den 45 Minuten, die sie durchschnittlich am Tag bewegt werden. Da ist viel Irrationales in der Debatte. Ich suche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ich habe das Buch geschrieben, weil ich zeigen wollte, dass nicht alle Leute, die ein Lenkrad in der Hand halten, das freiwillig machen.
Von welchen Zwängen berichten die Menschen in Ihrem Buch?
In den Interviews haben sich fünf Bedürfnisse herausgestellt, die Mobilität zu erfüllen hat. Klimagerechtigkeit kommt erst auf Platz fünf. Davor muss sie sicher, bezahlbar, barrierefrei und verfügbar sein. Erst wenn diese vier Punkte erfüllt sind, lassen die Leute ihr Auto stehen. Die steigen nicht in die Bahn, wenn sie beleidigt werden, weil sie nicht weiß sind. Die steigen nicht in den Bus, wenn sie nicht mit dem Rollstuhl reinkommen. Die können das 49-Euro-Ticket nicht kaufen, weil sie den Hartz-IV-Satz beziehen, der für Verkehr nur rund 40 Euro vorsieht. Und wenn auf dem Land kein Bus fährt, hilft selbst ein solches Ticket nichts.
In Ihrem Buch berichten Sie auch über die Schutzfunktion von Autos für Menschen, die sich im öffentlichen Raum unsicher fühlen.
Ja, es gibt zum Beispiel Studien, nach denen bereits 80 Prozent der unter 17-jährigen Mädchen und Frauen in der Öffentlichkeit sexuell belästigt worden sind. Die ändern ihre Wege, also auch ihre Mobilität. Es ist nicht überraschend, dass sich junge Frauen nach dem Führerschein sehnen, weil sie mit dem Auto sicherer und unabhängiger unterwegs sind. Transpersonen machen ähnliche Erfahrungen.
Was bedeutet das für die Mobilitätswende?
Das ist vielleicht die am schwierigsten zu bewerkstelligende Wende, weil sie mit gesellschaftlichen Problemen verbunden ist, mit Rassismus, Sexismus, Ungleichheit. Es gibt den schönen Satz des ehemaligen Bürgermeisters von Bogotá, Enrique Peñalosa: «Eine hoch entwickelte Stadt ist keine, in der die Armen Auto fahren, sondern eine, in der die Reichen öffentliche Verkehrsmittel benutzen.» In Wirklichkeit geht es um viel mehr, als nur das Auto gegen ein anderes Verkehrsmittel auszutauschen. Damit wir die Mobilitätswende hinbekommen, benötigen wir einen radikalen, also an die Wurzel gehenden gesellschaftlichen Wandel.
Sie fordern in Ihrem Buch, dass Menschen eine wirkliche Wahl haben sollten, welches Verkehrsmittel sie benutzen. Wie lässt sich das im ländlichen Raum verwirklichen?
Im ländlichen Raum sind zehn Prozent der mit dem Auto zurückgelegten Wege unter einem Kilometer, die Hälfte unter fünf Kilometern und 75 Prozent aller Autowege innerörtlich. Wie auch in der Stadt wird auch hier das Auto oft aus Bequemlichkeit gefahren. Für die Menschen, die wirklich ohne Auto aufgeschmissen sind, muss der öffentliche Verkehr weiter ausgebaut werden, auch die Feinverteilung, also die letzte Strecke bis nahe der eigenen Haustür. Das gehört zur Daseinsvorsorge, auch für Menschen, die nicht genug Geld haben oder nicht Auto fahren können oder wollen. Es gibt mittlerweile an die hundert Rufbus-Projekte in Deutschland, bei denen Busse ohne festen Fahrplan Fahrgäste aufsammeln. Das kann Mobilitätslücken schließen. Oder Scooter und Leihräder. Es braucht eine Gemeinschaft der Willigen: Verkehrsunternehmen, die ihr Angebot erweitern und für die Feinverteilung mit Taxi- und Scooter-Anbietern zusammenarbeiten, sowie Softwareanbieter, die Wege berechnen und Fahrzeuge koordinieren. Wenn wir zudem eine Radwegeinfrastruktur schaffen, die Menschen wirklich schützt, dann ist das E-Bike ein Riesending, weil sich damit gut pendeln lässt. Und man kann dann das Fitness-Abo weglassen und muss nicht mehr mit dem SUV zum Indoorcycling fahren.
Es können aber doch nicht alle Pendler aufs E-Bike umsteigen?
Die Zukunft liegt für mich auch in einer Veränderung der Arbeitswelt. Dass wir gar nicht mehr diese krassen Hauptverkehrszeiten haben, dass wir nicht alle um acht Uhr an einem Schreibtisch sitzen müssen, der irgendwo weit entfernt steht. Co-Working bietet da Chancen. Zum Beispiel, wenn sich mehrere Arbeitgeber zusammentun und einen Co-Working-Space aufbauen – somit müssen ihre Angestellten nicht mehr jeden Tag pendeln. Vielleicht kommt da noch ein kleiner Supermarkt rein, ein Café, schon stärkt man die Nahversorgung. So gewinnen Quartiere an Lebensqualität.

In den Großstädten gibt es viele Alternativen zum Auto. Dennoch steigt die Zahl der angemeldeten Pkws auch hier weiter an.
Ich wohne in Eimsbüttel, dem am dichtesten besiedelten Stadtteil Hamburgs. Hier gibt es alles: die U-Bahn, die zum Bahnhof fährt, Busse, Leihräder, Scooter, Taxis, Mietwagen. Aber man kann immer noch vor der Haustür parken. Und die Straßen sind voll mit privatem Blech. Wir können nicht nur durch Angebote Verhalten ändern, sondern müssen an die Autoprivilegien ran, an die Subventionen für Dienstwagen, das Dieselprivileg. Die wahren Kosten des Autofahrens sollte man auch abbilden. Viele sehen nur die Tankkosten und die Kfz-Versicherung, die einmal im Jahr kommt. Aber Wertverlust, Wartung und Reparaturen werden nicht eingepreist. Laut ADAC kostet selbst das günstigste Auto, aktuell ein elektrisch betriebener Smart, 300 Euro im Monat. Und dabei haben wir noch nicht mal ansatzweise berücksichtigt, dass jährlich Folgekosten im dreistelligen Milliardenbereich von Pkw-Fahrenden auf die Gesellschaft externalisiert werden.
Man muss die Bürger also erziehen, etwa indem die Gebühren für Anwohnerparken deutlich steigen?
Ich würde es eher als «entziehen» bezeichnen. Autofahrerinnen und Autofahrer haben viele Sonderrechte. Und sie rauben mir gute Luft, Ruhe und Raum. Das will ich zurückhaben! In Hamburg kosten zwölf Quadratmeter Wohnfläche ein paar Hundert Euro Miete im Monat. Warum soll ein Auto umsonst den gleichen Raum nutzen können? Ich habe viel Verständnis für Leute, die sagen: Ich brauche eine Lieferzone, ich brauche als Hebamme einen Parkplatz in direkter Nähe. Aber die Masse der Leute braucht keinen Parkplatz vor der eigenen Tür. Warum können Menschen, die ein Auto haben, nicht 500 Meter zu Fuß gehen und in einer Quartiersgarage parken? Das würde den Autofahrenden jede Menge Zeit bei der Parkplatzsuche ersparen. Und auf den Straßen mehr Platz schaffen. Ich kämpfe auch dagegen, dass jetzt E-Ladestationen an Straßenlaternen kommen sollen. Die Autos haben bitte auf ihren versiegelten Flächen zu fahren und nicht vor meiner Haustür zu parken. Man könnte die Gehwege wieder so breit machen, dass da auch Menschen im Rollstuhl lang können.
Im Sommer haben Sie eine Interrail-Tour durch europäische Städte unternommen und sich alternative Mobilitätskonzepte angeschaut. Was fanden Sie besonders überzeugend?
Ich war unter anderem in Luxemburg. Dort hat die Regierung eine neue Tram gebaut, das Zugsystem erweitert und den öffentlichen Nahverkehr kostenlos gemacht. Jetzt geht man an die Parkplätze ran und sagt: Ihr habt mittlerweile genug Alternativen! Für mich ist es komplett rational, so vorzugehen. Und Paris ist auf einem ähnlichen Weg, wenn auch nicht so weit. Die Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat von jetzt auf gleich 10.000 Parkplätze abgeschafft und begrünt. Sie hat die Seine von der achtspurigen Autobahn befreit. Stattdessen sind dort Naherholungsgebiete und Strände entstanden. Dieses «weg vom Auto» und «hin zum Menschen» ist für mich die einzige zukunftsfähige Vision.

Sehen Sie Anzeichen in Deutschland, dass solche Vorbilder Schule machen?
Bei uns geschieht vieles zu klein, zu zaghaft und zu langsam. In Hamburg ist der Jungfernstieg jetzt autofrei, aber gerade einmal auf 700 Metern – Taxis und Busse fahren weiter. Die Leute müssen den Gewinn an Lebensqualität deutlicher spüren als den Verlust der Autos. Wir haben in Deutschland die Möglichkeit der sogenannten «Verkehrsversuche». Man probiert etwas aus und fragt danach die Bürgerinnen und Bürger: Wollt ihr es behalten oder lassen wir es? Da gefällt mir gut, was in Berlin passiert.
Sie meinen das Projekt im Graefekiez in Berlin Kreuzberg, wo als Versuch private Parkplätze abgeschafft werden und Anwohner dafür in einem zentralen Parkhaus parken sollen?
Genau! Wenn man so etwas über einen längeren Zeitraum macht, lassen sich tatsächlich Gewohnheiten verändern.
Können wir als Bürger zu einem Wandel beitragen?
Die Politik muss die wichtigen Weichen stellen: mehr Geld in die Hand nehmen und den öffentlichen Nahverkehr fördern, statt weiter Autobahnen zu bauen. Ich schaue neidisch nach Österreich, wo ich im Beirat des Klimaschutzministeriums sitze: Dort richtet sich die Verkehrspolitik am CO2-Restbudget aus, das jedem Land laut Pariser Klimaabkommen noch zusteht. Das Ministerium hat ein Klimaticket geschaffen, mit dem man für drei Euro pro Tag regionale und überregionale Verkehrsmittel nutzen kann, auch die Schnellzüge. Gleichzeitig hat man den geplanten Bau eines Autobahntunnels bei Wien gestoppt, weil der zu mehr Autoverkehr geführt hätte. Als Bürgerinnen und Bürger können wir Druck ausüben, dass die Politik den Verkehr dekarbonisiert. Und wir können vor allen Dingen genauso laut werden wie die Autofahrer. Wir sind immer noch sehr höflich und sehr vermittelnd und wollen überzeugen. Vielleicht müssen wir 2023 einfach ein bisschen frecher werden.
Wer ist «wir»? Radfahrer haben inzwischen eine recht starke Lobby. Was ist mit den Fußgängern?
Wenn es um Radfahrer gegen Fußgänger gegen E-Scooter-Fahrer geht, macht man Fronten auf, die es eigentlich gar nicht gibt. Schließlich sind alle Menschen in bestimmten Situationen Fußgänger. Wir benötigen vielmehr so etwas wie eine Muskelmobilitätslobby. Wir sollten zusammenstehen als diejenigen, die mindestens gleichberechtigt mit dem Auto behandelt werden wollen. Und dabei besonders Kinder, Alte, Gebrechliche und Menschen, die auf Gehhilfen oder Rollstühle angewiesen sind, mitdenken und einbeziehen.
Sie weisen auf die gesellschaftliche Dimension der Mobilitätswende hin, dass bestimmte Personengruppen sich unsicher fühlen im öffentlichen Raum oder keinen Zugang zu ihm haben. Wie kann der öffentliche Verkehr inklusiver werden?
Gerade in der Feinverteilung brauchen wir weiterhin Personal – und eben nicht die Automatisierung, die alle gerade so abfeiern. Das sagen auch die Menschen, mit denen ich für mein Buch gesprochen habe. Sie wünschen sich – ähnlich wie bei der Deutschen Bahn – geschultes, nettes Personal, sowohl an Bahnhöfen als auch in den Waggons. Das Personal kann Auskunft erteilen, Ein- und Ausstiegshilfe geben, subjektive Sicherheit vermitteln. Wir brauchen nicht nur die Technik und die Systeme, sondern auch den Faktor Mensch.

Aber ist es nicht auch eine Frage der Technik? Viele Busse oder Züge sind nicht barrierefrei gebaut.
Eigentlich sollte der ÖPNV seit Anfang 2022 europaweit barrierefrei sein. Dass wir davon weit entfernt sind, ist die Folge jahrzehntelangen Versagens. Das lässt sich nicht so leicht aufholen. Die Frage ist, wer genau an dem Tisch sitzt, an dem Entscheidungen gefällt werden. Hier gibt es in Deutschland keine Diversität, da ist niemand dabei, der im Rollstuhl sitzt. Österreich hat vor Kurzem einen neuen «Nightjet» vorgestellt, der barrierefrei und mit dem Rollstuhl zugänglich ist. Der Zug wurde von Siemens Mobility gebaut, die auch unsere ICEs mit Stufen an den Türen herstellt. Die Industrie könnte die Politik deutlich besser bei der Planung inklusiver Verkehrsmittel beraten.
In den letzten Jahrzehnten wurden immer komplexere Fortbewegungsmittel ersonnen. Sind Flugtaxis und Hyperloops eine Lösung?
Ich weiß nicht, welches Problem Flugtaxis oder der Hyperloop lösen sollten. Beim Hyperloop rührt die Vision von Elon Musk daher, dass er selbst nicht Zug fahren will. Er hasst es, Räume mit anderen Leuten zu teilen. Für den Hyperloop müssten wir Tunnel bauen, was sehr viel CO2-Emissionen verursachen würde. Und das Ganze ist zudem extrem teuer. Da steckt eine Technikfaszination dahinter, die wie eine schillernd bunte Seifenblase schnell zerplatzt. Vor allem lenkt sie davon ab, dass wir alles längst schon haben – oder hatten. Zum Beispiel den Postbus, der Fahrgäste und Waren transportierte und den es etwa in Skandinavien und in der Schweiz noch immer gibt. Diese Technikfantasien lenken auch von dem ab, was wir ganz einfach tun könnten – zum Beispiel ein Tempolimit einführen.
Was halten Sie davon, Elektromobilität zu fördern?
Die einzige Elektromobilität, die gerade durch die Decke geht, ist die beim Fahrrad und bei der Bahn. Das haben wir ganz ohne Verkaufsprämien geschafft. Die Autoindustrie dagegen fordert eine staatliche Ladeinfrastruktur und Subventionen für E-Autos. Wie kann es sein, dass die Industrie noch immer nicht in der Lage ist, sich selbst zu erhalten? Und warum stecken wir all die Milliarden statt ins Auto nicht einfach in die Verkehrswende? Die E-Autos führen nur dann zur lokalen Emissionsfreiheit, wenn sie Strom aus Erneuerbaren tanken und einige Tausend Kilometer gefahren sind. Ich finde es problematisch, für ein Auto, das sich nur wenige Minuten am Tag bewegt, all die Ressourcen aus der Erde zu holen und zu verschwenden. Natürlich muss das Auto elektrisch werden. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt einfach 49 Millionen Autos elektrifizieren.
Sondern weniger Autos nutzen?
Weniger, kleinere, leichtere, alltagsgerechte und geteilte Autos. Und wir müssen wegkommen vom Pkw als Privatbesitz.
Was emotional schwer zu vermitteln ist, oder?
Wer Autofahren als Hobby begreift, kann das gerne tun, indem er oder sie sich – dementsprechend bepreist – auf dem Nürburgring austobt. Mein Verständnis für die Emotionen von Autofahrern ist ziemlich am Ende. Warum sollte ich darauf Rücksicht nehmen? Meine Emotionen als Radfahrerin spielen doch auch keine Rolle! Wenn ich mich morgens aufs Rad setze und durch Hamburg fahre, muss ich hoffen, dass ich abends noch lebe. Hier erwarte ich Lösungen seitens der Politik, anstelle von Hysterie und Terrorismusgerede, wenn sich jemand aus völlig berechtigter Sorge um unsere Zukunft auf die Straße klebt.

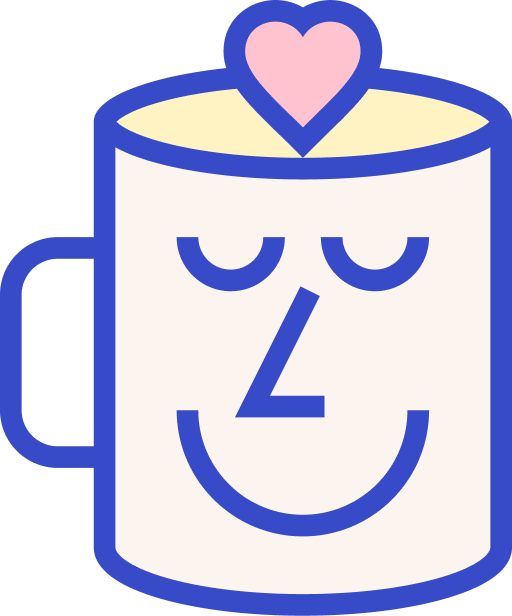
Schreibe einen Kommentar