Wir müssen endlich anerkennen, dass die Mehrheit der Menschen gar nicht Auto fahren will
Über das fossile Patriarchat und mangelnde Phantasie in der Mobilität sprachen wir mit Katja Diehl
Katja Diehl hat 15 Jahre lang im Bereich Marketing und Kommunikation, als Pressesprecherin und Abteilungsleiterin in verschiedenen Mobilitätskonzernen gearbeitet. Die Tätigkeiten in diesen Konzernen hat Katja Diehl mittlerweile hinter sich gelassen und engagiert sich heute für eine menschliche, inklusive, bezahlbare und klimagerechte Mobilität. Sie hat den „She Drives Mobility Podcast“ rausgebracht, ist Autorin des Bestsellers „Autokorrektur“ und berät u.a. die österreichische Klimaschutzministerin.
UCA: Frau Diehl, hat Ihre vergangene Führungsposition als Frau dazu beigetragen, dass bei Ihnen Frauenthemen so im Fokus stehen oder war das Interesse schon vorher da?
Katja Diehl: Meine Themen waren nicht immer speziell Frauenthemen, aber ich war schon immer kund*innenorientiert. In den Konzernen habe ich gemerkt, dass es einen Unterschied gemacht hat, dass ich eine Frau bin. Meine Kolleg*innen waren total technikaffin und fragten mich, ob ich Alexa kenne, weil die unbedingt Alexa Skills in 14 Jahre alte Busse einbauen wollten. Das bringt aber den Kunden oder die Kundin nicht weiter, wenn die Busse trotzdem nur nach ihrem Soll fahren. Es war schon auch anstrengend, dass ich mich häufig rechtfertigen musste in einer Führungsposition zu sein. Ich hatte auch irgendwann zwei Kleiderschränke, einen privaten und einen mit Kleidung für die Arbeit, damit es möglichst wenig optische Reibungsflächen gab.
UCA: Schauen wir auf das Thema Geschlechtergerechtigkeit in Bezug auf heutige Mobilitätsstrukturen. Wie groß ist der Handlungsbedarf, den wir in Bezug auf die Verkehrsträger in Deutschland haben?
Katja Diehl: Handlungsbedarf sehe ich schon bei der Sprache und der Intersektionalität. Ich merke an mir selber, dass ich mich bemühe, bestimmte Begriffe zu vermeiden, die Leute so triggern können, dass es sie auslädt. „Feminismus“ zu sagen ist für manche schon das erste Ausstiegskriterium. Gender Planning allein reicht auch nicht, Intersektionalität muss immer mitgedacht werden. Ich versuche anstelle von Gender Planning von Gleichberechtigung auf der Straße zu sprechen oder davon, dass wir eine Autokratie haben. Ich versuche auch allgemein die ganzen Narrative zu hinterfragen. Wir brauchen nicht nur wegen der Klimakatastrophe, sondern auch wegen der herrschenden Ungerechtigkeit im Mobilitätssystem neue Herangehensweisen. Das System passt vor allem für die mittelalten, weißen Männer. In der Pandemie haben Frauen wieder die Arbeitszeit verkürzt, haben das Homeschooling gemacht und sich um die zu pflegenden Personen gekümmert. Das waren nicht die Männer. Und da muss ich sagen, dass sowohl im Auto als auch im ÖPNV und in der Radindustrie das gleiche Problem herrscht: zu wenig Frauen an der Macht. Und das ist nur der erste Schritt von Diversität. Tatsächlich sind ÖPNV-Systeme schon immer so aufgebaut, dass sie vor allem der Erwerbstätigkeit des Mannes dienlich sind. Sie führen immer strahlenförmig vom Zentrum in alle Richtungen. Es fehlen Zwischenbeziehungen. Und beim Radverkehr fehlt eine sichere Rad-Infrastruktur. Also auch der Radverkehr ist sehr männlich, denn der Mann fährt trotz der Unsicherheiten Rad und lässt sich das nicht nehmen. Natürlich ist Automobilität dann etwas, was sich wie eine Lösung anfühlt, wenn man damit die Probleme von Rassismus, Sexismus, des sich nicht sicher Fühlens usw. lösen kann.
Weil viele Frauen jetzt leider auch in die Automobilität gehen, ist das mit dem Thema Gender für mich immer so ein bisschen schwierig. Leslie Kern schreibt in ihrem Buch „Feminist City“, dass die Frauen, sobald sie raus aus der Stadt gehen, vom Auto abhängig sind. Vorher konnten sie in der Stadt noch ihre kurzen Wege erledigen, das ist ja auch schon nicht mehr in jeder Stadt möglich. Die Stadt und der ländlicher Raum waren mal gesund, es gab noch bis in die 60er hinein fußläufige Reichweiten, die Leute haben sich 60% Fußwege leisten können, weil Arbeit, Wohnen usw. nicht weit auseinander lagen. Die Entfernungen kamen erst durch das Auto. Das ist dann der Moment, wo das erste Mal die Abhängigkeit der Frau von dem Auto stattfindet. Also Gender Planning ist für mich etwas, was insofern schwierig ist, weil wir den Status Quo hinterfragen müssen, der aber heute als Erfolg und Freiheit angesehen wird. Meiner Meinung nach braucht Gender Planning insgesamt eine Entschleunigung des Systems, weil die Geschwindigkeit „Auto“ ziemlich unmenschlich ist. Wir leben in einer unglaublich durchgetakteten, industrialisierten Welt mit dieser komischen Vierzigstundenwoche, die aus dem Schichtbetrieb der Industrie kommt und die eigentlich für uns Wissensarbeitende überhaupt keinen Sinn mehr macht. Wenn Care Work nicht aufgeteilt wird, dann bleibt das Mobilitätssystem autobasiert, weil sonst diese Hektik einfach nicht zu schaffen ist.
Die erste Regel der Verkehrswende ist immer noch: Wege nicht antreten zu müssen. Also z.B. Coworking auf dem Land oder Nahversorgung wieder auf‘s Land zu bringen. Das sind Aspekte, die nur jemand kennt, der nicht diese männliche Erwerbsarbeit macht. Diese Wegeketten, dieses Hin und Her zwischen Wohnen und Arbeiten, haben die Frauen oder zumindest die Care-Personen; die hat der Mann statistisch nicht.
UCA: Die gerechte Stadt bedeutet letztendlich also auch eine qualitative Verbesserung für Männer. Indem wir entschleunigen und alle ein bisschen mehr zur Ruhe kommen und uns von alten Prämissen verabschieden, die sich überholt haben. Es profitieren also alle?
Katja Diehl: Als ich aus dem Konzern raus bin, hat ein Kollege gemeint, dass ich ein Sterbezimmer hätte, weil so viele bei mir kondolierten. Es waren tatsächlich nicht wenige Männer, die meinten, dass ihnen meine Stimme fehlen wird. Und das waren ausgerechnet die Kollegen, die mich immer allein gelassen haben, wenn ich versucht habe, Dinge zu verändern. Die immer, wenn wir kritische Punkte angesprochen haben, hinter mir geblieben sind und abgewartet haben. Da waren ganz viele, die davon profitiert haben, dass ich so bin, wie ich bin, die aber nicht mitgemacht haben, sich nicht getraut haben, weil es bei Männern vielleicht sogar schwieriger ist, so zu ticken.
UCA: Wenn wir schon bei dem Thema „Schaffen“ sind: Was sind denn die großen Hürden, die es zu nehmen gilt? Oder wo sehen Sie vielleicht auch schon ein bisschen Rückenwind, den man nutzen könnte?
Katja Diehl: Leonore Gewessler, die Klimaschutzministerin in Österreich und damit Führungskraft ist, hat ein Bild, eine Vision. Das würde ich ehrlich gesagt Leuten wie dem Volkswagen-CEO und vielleicht auch Volker Wissing absprechen, die haben eher sowas Mechanistisches im Kopf. Ich könnte stundenlang erzählen, wie es zukünftig vor meiner Haustür aussehen soll. Die mangelnde Phantasie ist ein ganz großer Hemmschuh, weil wir nur die Verluste und nicht die Gewinne für alle sehen. Das ist so ähnlich wie in der Corona-Politik. Wir hören auf die Lauten. Die, die an der Automobilität nichts verändert wissen wollen, die, die an der Tanksäule stehen und wütende Handyvideos machen. Der Betrieb eines Autos ist 35% teurer geworden, der ÖPNV aber 85%. Ich würde gerne mal wütende Leute am Ticketautomaten sehen. Die Gruppe, die wirklich darauf angewiesen ist, ist eine Gruppe, die keine Stimme hat. Das sind arme Menschen, das sind Menschen, um die sich Parteien und Politiker nicht bemühen. Der Wind, der da entgegen strömt, ist vor allen Dingen der Verlust von Privilegien. Das Recht auf den eigenen Parkplatz vor der Tür gibt es nicht, gefühlt ist dem aber so. Das ist schon so ein bisschen das fossile Patriarchat. Die Lobby ist einfach sehr stark. Andererseits können wir uns den Marlboro-Mann und dass früher einfach überall geraucht wurde heute auch nicht mehr vorstellen. Leute, die jetzt z.B. in autobefreiten Bezirken in Wien wohnen, waren am Anfang auch krass dagegen. Und jetzt will keiner mehr die Autos dort, weil der Vorteil erlebbar ist. Wir können uns das nicht vorstellen, wir sind nicht in der Lage dazu. Ich stand letztens in meinem Haus und mein Nachbar, der Ingenieur ist, meinte, was denn wäre, wenn die Autos weg sind? Also auf jeden Fall gibt es dann keine leeren Parkplätze! Da kann man sich lustig drüber machen, aber ich glaube, das ist ein ganz großer Hemmschuh, dass diese Sehnsucht nach dem, was danach kommt, nicht entsteht, weil es sich nicht vorstellen lässt.
UCA: Das heißt, wir brauchen eine Vision, die nicht abstrakt ist, sondern den Leuten quasi bildlich vor Augen führt, wie ihr eigenes Leben aussehen kann und was sie gewinnen?
Katja Diehl: Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin in Paris, macht das super. Sie arbeitet unglaublich gut und pragmatisch mit Visualisierungen, wie die 15-Minuten-Stadt aussehen kann und was wir alles in 15 Minuten erreichen. Sie pflanzt jetzt ungefähr 16.000 Bäume und hat 10.000 Parkplätze abgebaut – sie reißt so richtig schön das Pflaster ab. Das tut dann erstmal weh, aber dann sehen alle, dass da ein Naherholungsgebiet mitten in der Stadt entstanden ist. Das ist, was wir bräuchten. Die österreichische Politikerin Birgit Hebein, die leider abgewählt wurde, weil sie so autobefreit agiert hat, hat zu Beginn der Pandemie gerade in den prekären Stadtteilen Wiens gesagt, dass sie dort begehbare Straßen brauchen, weil die Leute dort auf engstem Raum ohne Balkon zusammenwohnen. Sie hat dann kurzerhand die Straßen von den Autos befreit. Da waren Wasserspiele, da haben Kids auf der Straße gespielt und konnten der Mama auf dem Balkon zurufen. Kinder sind viel zu selten draußen, meistens in der Begleitung von Erwachsenen und immer von geschlossenem Raum zu geschlossenem Raum. Die Eltern haben heute so einen Über-Protektionismus, der auch nachvollziehbar ist aufgrund der Autogewalt, aber der nimmt einem Kind natürlich die kognitive und selbstbestimmte Entwicklung.
UCA: Schauen wir mal speziell in den Bereich des öffentlichen Nahverkehrs: Wo sehen Sie da in Bezug auf Gleichberechtigung oder Gender Planning besonderen Nachholbedarf?
Katja Diehl: Auf jeden Fall beim Personal. Wenn das autonome Fahren kommt und es zu und in bestimmten Tages- und Randlagen kein Personal an Bord gibt, ist das ein Problem. Es ist super wichtig, dass Sie am Hauptbahnhof um 22:00 Uhr noch die Möglichkeit haben, sich irgendwo aufzuhalten und dass der Raum rund um die Uhr gut beleuchtet ist, wo ein Snackautomat steht und es eine nette Person in Uniform gibt, die sich kümmert. Es braucht aber auch Zwischenbeziehungen. Aktuell ist das Bus- und Bahnsystem sehr starr, man kann nicht so flexibel agieren. Diese Mobilitätslücken müssen aufgefüllt werden, sei es mit Leihrädern oder Scootern auf dem Land, mit denen man von zuhause zum nächsten Regionalbahnhof fahren kann. Man hat bei den Leihfarrädern, an denen kleine Körbchen befestigt sind, zum Beispiel festgestellt, dass diese sehr viel mehr von Frauen genutzt werden. Es sind solche kleinen Details, die zeigen, dass man das auch mit Kund*innen entwickeln sollte. Die Deutsche Bahn hat den Ideenzug entwickelt, da gibt es zum Beispiel eine Halterung in der Toilette, wo man das Baby reinpacken kann, wenn man selber pinkeln muss. Es gibt dort auch keine gegenderten, sondern unisex-Toiletten. Und vor dem Klo gibt es die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen, weil rausgefunden wurde, dass viele Menschen einfach nur Händewaschen wollen, dadurch aber den Klobetrieb aufhalten.
UCA: Sie haben gerade selbst schon das Thema des autonomen Fahrens angesprochen. Was sind Ihres Erachtens die überwiegenden Vor- und Nachteile, insbesondere in Bezug auf die Geschlechtergerechtigkeit?
Katja Diehl: Ich finde, es ist gerade in dem Sinne eine schlechte Entwicklung, dass Frauen ihre Mobilität nur lösen können, indem sie sich ein Auto anschaffen. Für mich ist immer wichtig, dass wir nicht vergessen, dass 13 Mio. Erwachsene keinen Führerschein haben und dass es okay ist, zu sagen „ich möchte nicht Auto fahren“. Das ist in Deutschland überhaupt nicht anerkannt. Ich weiß von vielen, dass sie Autofahren stresst. Das sind auch nicht wenig Frauen, die das sagen. Und dann gibt es natürlich noch die Kinder, die keinen Führerschein haben, weil sie zu jung sind und das sind ja meistens die, die von den Frauen begleitet oder transportiert werden müssen. Das Rausziehen aufs Land verursacht unglaublich lange Wegestrecken, damit die Kindermobilität im Sinne von Hobbys usw. erhalten bleibt. Im Einzelfall habe ich da auch Sympathie und Verständnis für, aber in der Masse ist das echt ein Problem. Die Anzahl der Wege hat sich seit der Neandertalzeit nicht verändert, aber die Wegelänge ist durch das Auto viel größer geworden. Da brauchen wir auch eine Entschleunigung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Hektik für manche auch ein Teil ihres Status ist. Das sind alles Sachen neben Gender Planning, auf die wir auch achten müssen. Ich glaube, wenn wir die Möglichkeiten nutzen, die sofort umsetzbar sind, wenn man nicht nur Angebote schafft, sondern auch das Auto genauso unbequem macht wie alles andere, Parkflächen wegnimmt usw., dann können wir etwas erreichen.
Wenn man Angebote hat, wie das 9€ Ticket, dann nutzen die Leute das und fahren einfach, denn sie müssen sich nicht mit Verkehrsverbünden beschäftigen, nicht überlegen, ob sie heute nur einmal fahren oder zweimal und welches Ticket das Richtige ist. Gender Planning bedeutet für mich auch in solche Systeme reinzugucken und natürlich auch die Arbeitgeber*innen zu adressieren: Dienstwagenprivileg für wenige oder Mobilitätsbudget für alle? Gute Radabstellanlagen sind auch Möglichkeiten, die es leichter machen, umzusteigen. Und ich glaube auch gerade im ländlichen Raum, wo 50% der Wege unter 5 Kilometern sind, ist viel Kraft für Radverkehr bei gesunden Menschen. Ich glaube aber, dass es beides braucht. Einmal die Angebote, aber auch das Loslassen von Statussymbolen. Es kann nicht sein, dass wir immer wieder unsere Freiheiten nach vorne stellen und einfach missachten, dass Automobilität die schlimmste und folgenreichste Mobilität ist.
Wenn dann noch „Vision Zero“ hinzukommt, also die Vision, keine Verkehrstoten zu haben, was seit Jahren zum Beispiel in Helsinki gelingt – da ist seit 2017 kein Kind mehr auf den Straßen gestorben – dann entlastet das auch wieder die Eltern. Manche Eltern, die drei oder vier Kinder haben, können die gar nicht überall hin transportieren oder begleiten, wie soll das gehen? Es wäre doch gut, wenn Eltern auch ein gutes Gefühl haben, wenn sie ihre Kinder alleine auf dem Rad fahren oder zu Fuß gehen lassen.
UCA: Es gibt Länder, in denen zu bestimmten Zeiten nur Frauen den Zug benutzen können oder es spezielle Frauenabteile gibt. Funktioniert sowas? Oder gibt es andere konkrete Beispiele, die Sie kennen, die gut funktionieren?
Katja Diehl: Ich möchte eine Mobilität erwirken, die kein Outing braucht. Warum bringen wir Menschen immer in die Situation, zu sagen, dass sie dieses oder jenes Klo brauchen? Wir müssen Lösungen schaffen, wo sich alle wohlfühlen, wo Gender einfach keine Rolle mehr spielt. Bevor wir solche separierenden Geschichten machen, sollten wir die bestehenden Angebote verändern, also zum Beispiel ein Körbchen am Fahrrad oder zusätzliche Gepäckablagen.
Es gibt immer noch Schlaumeier, die mir erzählen, dass die meiste Gewalt zuhause stattfindet. Ja, aber trotzdem sollten wir dafür sorgen, dass die öffentlichen Räume sicher sind. Die Wege zum Bahnhof sind da manchmal einfach schon eine Klippe, weil die komplett zuuriniert, nicht gepflegt, oder nicht hell sind und es kein freundliches Personal gibt, was dort zu Fuß patrouilliert und ein Sicherheitsgefühl vermittelt. Ich wünsche mir, dass das einfach mal angenommen wird, dass es einen erhöhten Bedarf gibt, sich sicher fühlen zu können. Es gab auch schon Aktionen in anderen Ländern, wo Aufkleber in U-Bahnen waren: Was ist zu tun, wenn ich Zeug*in bin? Bei welcher Nummer kann ich sofort Hilfe holen? Dass man darauf abzielt, dass man mal wieder ein bisschen die Zivilcourage fördert. Vielleicht ist das auch irgendwann mal Teil des Schul- oder Kindergartenunterrichts. Kinder und Schüler*innen können sich auch gar nicht mehr mit dem ÖPNV bewegen, weil die Eltern das ja schon nicht können. Manche können nicht Rad fahren. Das gehört vielleicht auch zu Gender Planning dazu, dass wir bestimmte Sachen auch in der Schule verankern müssen.
UCA: Sie haben vorhin betont, wie wichtig eine Vision ist. Uns würde interessieren, wenn alles umgesetzt ist, was Sie sich so vorstellen, wenn wir in einer gerechten und gleichberechtigten Stadt leben, wie sieht denn dann die Mobilität aus?
Katja Diehl: Dadurch, dass die Stadt weniger Automobilität hat, wird sie sicherer, weil sich die Räume wieder anders durchmischen. Wir holen alles wieder in die Stadt. Die 15-Minuten-Stadt ist auch ein 15-Minuten-Dorf. Es gibt sogar Leute, die sagen, dass bestimmte Handwerksbetriebe wieder in die Stadt sollen. Alles, was wir mal outgesourct haben, was nicht so belastet ist, kann eigentlich wieder in die Stadt. Ich möchte, dass ärztliche Versorgung, Bildung, Kultur, Essen in fußläufiger oder radläufiger Entfernung ist. Dadurch hat man nicht nur ein Shoppingviertel, ein Kulturviertel und ein Feierviertel, was zu bestimmten Tages- und Randlagen immer leer ist und sich komisch anfühlt. Ich möchte eine durchmischte Stadt, wo man viel mehr soziale Kontrolle hat, weil sich viel mehr Menschen mit unterschiedlichen Beweggründen in dieser Stadt bewegen. Der Raum zwischen den Häusern gehört dann wieder den Menschen, die Autoabstellflächen sind weg, man hat Urban Gardening, vielleicht sogar Selbstversorgung, man lebt vielleicht in Generationshäusern, wo man füreinander Sorge trägt. Meiner Meinung nach arbeiten wir in der Zukunft auch nicht mehr 40 Stunden, sondern vielleicht 20 Stunden und es gibt das bedingungsloses Grundeinkommen, damit Leute nicht mehr drei Jobs machen müssen, wofür sie auch ständig unterwegs sein müssen. Dann ist auch viel mehr Platz für Ehrenamt und andere Dinge. Also, das ganze Leben muss sich einfach anders gestalten.
UCA: Was muss sich in Stadtpolitik am dringendsten ändern, dass wir so einer Vision etwas näherkommen?
Katja Diehl: Den größten Handlungsbedarf sehe ich tatsächlich darin, alle an den „Machttisch“ zu bringen, sogar Kinder würde ich mitnehmen. Ich kann dann an manche Dinge noch mal viel naiver und befreiter gehen. Ich glaube, es würde 2022 keinen ICE mehr mit Stufen geben, wenn Menschen mit einem Rollstuhl an dem Tisch gesessen hätten. Oder BiPOC-Personen, also Schwarze, Indigene und People of Color, wenn es darum geht, wie wir sicher unterwegs sein können. Was machen die 13 Mio. Menschen, die keinen Führerschein haben? Bleiben die Zuhause? Wahrscheinlich schon. Das müssen wir ernst nehmen, dass diese privilegierte, weiße Mehrheitsgesellschaft etwas gebaut hat, das super viele Leute bereits ausgeschlossen hat. Umso mehr sollten wir Leute fragen: Musst Du Auto fahren? Warum sitzt Du eigentlich im Auto? Dabei kommt dann raus, dass die Leute das gar nicht wollen, sondern ihnen die Alternativen fehlen, weil sie sich nicht sicher fühlen, weil sie nicht barrierefrei unterwegs sein können. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass ein Volker Wissing nicht so, wie er es getan hat, als erstes mit der Autoindustrie redet, sondern mit der Zivilgesellschaft. In Deutschland ist es unglaublich schwer, Dinge zu verändern, weil wir eine so große Lobbyindustrie haben. Das zu durchbrechen und zu sehen, dass das Auto eben nicht die Lösung ist, sondern einfach nur Probleme kaschiert, die dahinter liegen.
UCA: Wir haben in unseren Projekte die Erfahrung gemacht, dass solche diversen Diskussionsrunden, abgesehen davon, dass sie am produktivsten waren, auch am meisten Spaß gemacht haben.
Katja Diehl: Viele Sachen entstehen auch erst, wenn man ein bisschen locker an die Sache herangeht, und das passiert natürlich bei der Mischung von Gruppen. Der Ideenzug hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil dort ganz unterschiedliche Menschen waren, aber auch der ist leider wieder ableistisch, weil er mit Stufen ist und keine Menschen mit Behinderung dabei waren. Das ist auch automatisch eine Schwierigkeit für Leute mit Kinderwagen oder Rollator. Deutschland ist da super schlecht, obwohl wir seit dem 1.1. diesen Jahres ÖPNV barrierearm machen müssen. Ich habe das Gefühl, da drücken sich einige Akteure auch davor, weil sie es einfach nicht können. Manchmal muss auch der Schmerz ertragen werden, was nicht zu können und sich der Sache dann zu stellen.
UCA: Gibt es noch ein Thema, das Sie unbedingt in diesem Interview ansprechen wollen?
Katja Diehl: Die Intersektionalität. Mich nerven mittlerweile auch Frauennetzwerke, muss ich ehrlich gestehen, weil die einfach nicht weit genug gehen und es sich bequem machen. Ich bemerke leider in der Mobilitätsbranche, dass die Frauen schon satt sind, wenn sie selbst Macht haben. Es kommt auch leider sehr viel Neid und Missgunst aus der eigenen Blase. Es reicht nicht 50% Frauen an den Tisch zu bringen, es muss sehr viel weiter gehen. Man muss die Planung immer bei den „Schwächsten“ beginnen, denn davon haben fast alle immer etwas. Ich werde irgendwann eine neue Hüfte brauchen, daher merke ich mittlerweile, wo Bänke sind und wo nicht. Nämlich fast nirgendwo. Daran merke ich, wie rationalisiert wir mit Raum umgehen. Frauen einzubeziehen macht auch so viel mehr Spaß, weil wir dann wirklich die bessere Mobilität bauen und nicht die von weißen alten Männern übernehmen und nur ein paar Brüste drankleben. Wir müssen das als einen Lernprozess sehen. Natürlich ist das nicht immer cool zu merken, dass ich was vergessen habe, aber ich lerne wirklich mit Freude dazu und umarme das dann auch, dass ich auch mal kritisiert werde. Der Fehler passiert mir dann eine Woche später nicht mehr. Das finde ich so schade, dass man lieber geduckt bleibt, um nichts verkehrt zu machen, anstatt sich mal raus zu wagen. Es hakt immer noch viel zu oft an diesem einen ersten Schritt. Wir sind immer noch nicht dabei, das zu verändern, weil alle in Deutschland keinen Bock haben, Fehler zu machen. Das ist echt schade.
UCA: Ja, bezüglich der Lernkultur, die wir brauchen, um Zukunft aktiv zu gestalten, haben wir noch einiges vor uns.
Katja Diehl: Aber wir sind ja dran.
Vielen Dank für das Interview!
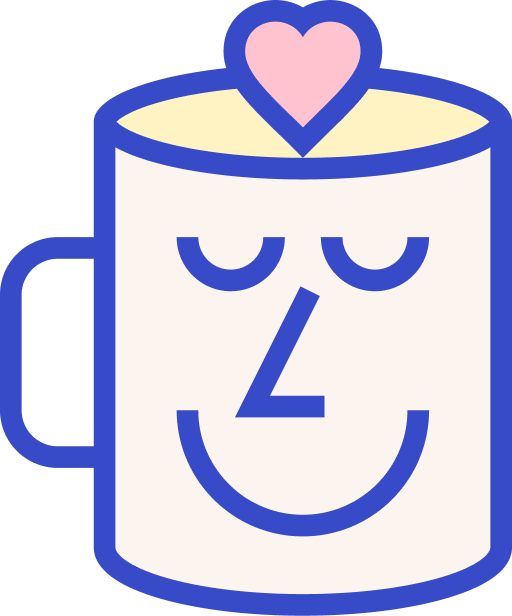
Schreibe einen Kommentar