GLS Bank: Katja, du nennst deine Kampagne für eine Mobilitätswende „Autokorrektur“. Heißt das, die Autos müssen weg? Oder heißt das, die Wende wird von selbst kommen?
Katja Diehl: Autokorrektur heißt für mich, dass Autos nur noch da zum Einsatz kommen, wo es wirklich notwendig ist. Ich sehe in der Stadt keine Notwendigkeit für privaten Auto-
besitz. Sinnvoller wären Modelle, wo Fahrzeuge gemeinsam genutzt werden. Vor allem müssen wir näher hinschauen, wie viele Menschen heute Auto fahren, obwohl sie es gar nicht wollen. Da sind wir beim Thema Autokorrektur des öffentlichen Raums. Wenn zum Beispiel BIPoC-Personen
oder Transfrauen im öffentlichen Raum nicht sicher sind, weil sie Übergriffe fürchten müssen, werden sie weiterhin Auto fahren. Verkehrswende ist nicht nur Mobilitätswende,
sondern gesellschaftlicher Wandel. Diese Ansage macht offenbar manchen Autofahrenden
Angst.
Ich hasse keine Autos, sie sind praktisch. Aber im Gegensatz zum Beispiel zu einem Kühlschrank, der ebenfalls praktisch ist, stehen sie im öffentlichen Raum herum. Da stellt sich also die Frage von Raumgerechtigkeit. Menschen, die kein Auto besitzen, erfahren hier Einschränkungen. Wir sollten also innehalten und die Perspektive ändern.
Würde Freiheit genommen, wenn es eine Autokorrektur gäbe? Durch die Pandemie haben wir im ersten Lockdown kurzzeitig eine erlebt. Da zeigte sich, zu wie viel Veränderung wir in der Lage sind — auch wenn Corona kein positiver Anlass war. Autokorrektur heißt also, es geht um mehr als Autos. Du bringst eine andere Definition von Freiheit im öffentlichen Raum ein. Wie sieht es mit dem Faktor Zeit aus?
Vor Corona war Hektik ein Statussymbol. Menschen mit Macht haben nie Zeit, müssen Coffee-to-go trinken, im Auto essen und häufig fliegen. Familienmobilität funktioniert zudem mit unserer jetzigen Infrastruktur oft nur mit Auto. Eine Alleinerziehende sagte mir bei meiner Recherche für
mein Buch, dass sie wegen ihrer Arbeitszeiten keine der Kitas in ihrer Nähe nutzen kann. Also muss sie eine weiter entfernte mit dem Auto ansteuern. Und damit sind wir plötzlich mitten in der Diskussion um den Wert von Care-Arbeit und beim Feminismus. In unserer Gesellschaft sollte
es allen gut gehen. Dafür müssen Privilegien anders verteilt und vor allem endlich geteilt werden.
Was bedeutet das konkret, Privilegien teilen?
Den größten CO2-Fußabdruck hat mit 25 Prozent Anteil das reichste ein Prozent der Menschen. Warum nehmen wir die armen Menschen als Ausrede dafür, dass sich nichts ändern dürfe? Gerade sie hätten viel von einer Veränderung. Es dient also nur der Status-quo-Bewahrung, wenn sich dagegen gewehrt wird. Nur weil ich ein Auto habe, das ich vor der Tür parken darf, heißt das nicht, dass das auch Recht ist. Das ist ein Gefühl von Recht. Geteiltes Privileg wäre, wenn ich da mein Sofa hinstellen könnte, wenn ich keine Autobesitzerin bin. Oder die Autobesitzer zahlen für ihren Parkplatz.
Du hast Feminismus erwähnt. Warum kommt der ins Spiel bei der Mobilitätswende?
Viele, die etwas verändern könnten, wollen nichts verändern. Das liegt an mangelnder Diversität in Politik, Unternehmen, Entscheidungsgremien. Dort fehlt schlechtweg die Fantasie, dass die eigene Automobilität nicht die von anderen ist. Die Lastenraddiskussion neulich war doch krass: Warum regen sich Leute auf über 1.000 Euro Lastenradförderung, aber nicht über 9.000 Euro, die der Staat für einen Neuwagen zuschießt? Eine konsequente Mobilitätswende geht zwangsläufig an Werte und Normen, hinterfragt rassistische und sexistische Strukturen. Eine Verteidigungsstrategie der Bewahrer ist Whataboutism — sie verweisen dann zum Beispiel auf den ländlichen Raum, wo man ja ohne Auto nicht leben könnte. Und ja: Viele Menschen auf dem
Land fühlen sich von solchen Debatten bedroht, weil sie ja gerade noch keine andere Möglichkeit haben, mobil zu sein. Deshalb lohnt sich die Frage:
Willst oder musst du Auto fahren?
Wie durchbrechen wir diesen Teufelskreis aus Abwehr-
haltung und fehlenden Alternativen zum Status quo?
141 Milliarden Euro pro Jahr fließen insgesamt in den Auto- verkehr und seine Folgen, dazu zählen auch die Toten und Schwerverletzten. Da mal hinzuschauen, wie viel Geld fließt, wie viele Subventionen das Auto bekommt, das lohnt sich. Würde das Produkt ehrlich bepreist werden, würde niemand mehr Auto fahren, weil es einfach viel zu teuer wäre. Das fängt beim kostenlosen Parkplatz an, geht mit dem Diesel- und Dienstwagenprivileg weiter und endet bei Steuersubventionen. Das alles für ein sehr schädliches Produkt, das man eigentlich nur nutzen sollte, wenn es gar nicht anders geht. Es wird aber verkauft wie Fast Food. Die Autobranche schreit danach, reguliert zu werden. Dann würde sich auch etwas bewegen in Sachen Mobilitätswende. Allein schon bei der Stadtgestaltung: Nur 46 Prozent der Kinder sind regelmäßig täglich draußen. Wenn Kinder sich kaum noch frei bewegen können, hat das auch einen Gesundheitsaspekt. Und Gesundheit darf etwas kosten.
Warum sieht die deutsche Automobilindustrie da nicht viel mehr Potenzial für neue Geschäftsfelder? Auch die Autobosse müssten wissen, dass Mobilitätswende mehr ist, als ein paar Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Die Rufe werden lauter: Wo bleibt der deutsche elektrische
Kleinwagen? Diese Industrie ist getrieben von Exceltabellen, Quartalsberichten, Aktiennotierungen. Das ganze System ist kaputt. Die Autoindustrie tut leider genau das Gegenteil von dem, was dem Gemeinwohl guttäte. Denn sie muss dicke Autos verkaufen, um die Elektromobilität bezahlen zu können. Die Bundesregierung hatte mal das Ziel, dass 2020 eine
Million Elektroautos zugelassen sind. Sie hat es sich aber selbst zuzuschreiben: Als Verkehrsministerin hätte ich als Bedingung für die Milliardensubventionen verlangt, dass die
Industrie zum Beispiel Lösungen für den Nahverkehr auf dem Land entwickelt, wie kleine Elektrobusse.
Wie können wir als Gesellschaft den Druck erhöhen?
Es gibt allein 42 Radentscheide in Deutschland, zunehmend auch im ländlichen Raum. Solche Aktionen, durchaus auch ziviler Ungehorsam wie bei den Protesten gegen Autobahnbau oder jetzt gerade gegen die IAA, ermutigen andere Menschen, eine andere Mobilität, andere Städte zu fordern. Viele sagen sich: Ich will meine Zeit nicht im Auto verbringen, sondern aktiv sein. Wenn Kommunen darauf eingehen und Fuß- und Radwege bauen, werden diese genutzt und die Zufriedenheit steigt. Infrastruktur muss erst einmal da sein. Anders ist es bei Autobahnen: Werden sie gebaut, wird der Verkehr nur schlimmer, es reicht aber nie. Viele Menschen suchen sich bereits ihren Job danach aus, ob sie eine autofreie Anbindung dort haben. Ich hoffe, dass sich die Städte verändern, damit Stadtbewohner*innen nicht mehr ständig dem Stress entkommen müssen, sondern der Urlaub vor der Tür beginnt. Ein vielversprechendes Modell ist die 15-Minuten-Stadt.
Was können Unternehmen beitragen?
Arbeitgeber sollten eine Mobilitätsprämie für alle vergeben und den Dienstwagen abschaffen. Wenn auch Menschen mit nicht so hoch bezahlten Jobs sich ein gutes Fahrrad als Jobrad leisten können, kann ein Umdenken beginnen. Wenn es eine Unternehmensflotte aus verschieden großen Elektroautos gibt, die auch Anwohner nutzen können. Es gibt bereits viele tolle Ideen und Lösungen — aber die gehören aufs Land, nicht in die Stadt. Da würde ich meine Steuern viel lieber investiert sehen als in eine Autokultur, von der ich gar nichts habe.
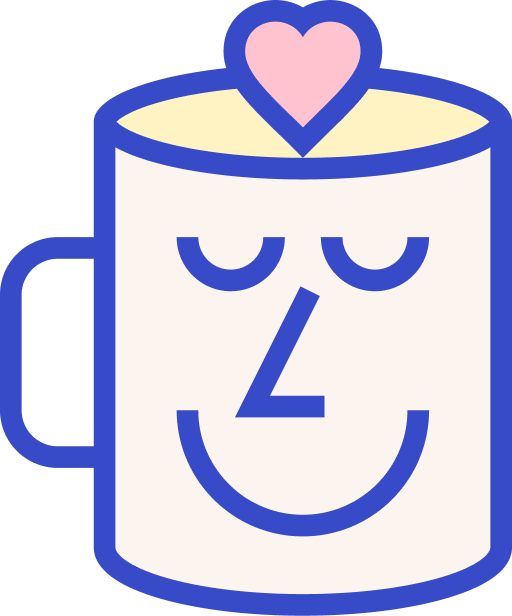
Schreibe einen Kommentar