Eine Bekannte verschweigt sieben Wochen, dass sie eine Prüfung im Studium nicht geschafft hat – und damit das Studium beendet ist. Sie hat einen tollen Job und sich das Studium „on top“ aufgeladen. Aber das spielt in dem Moment keine Rolle.
Ein Freund, der mich immer wieder in Gesprächen fragt, was er schon „geschafft“ habe. Alle Projekte, die ihm wichtig waren, seien gescheitert. Dass diese Projektideen von anderen begeistert aufgenommen wurden und er Mentor war, interessiert ihn nicht. Weil er „nur“ inspiriert, und nicht beendet hat.
Das sind nur zwei Beispiele, die mich auf die Idee brachten, dieses so genannte „Scheitern“ zu thematisieren. Weil ich es in meinem Leben nicht kenne. Woran liegt das?
Scheitern als Bedrohung
Ich habe mal meine Twitterblase gefragt, was sie über das Scheitern denkt. Und anscheinend einen Nerv getroffen, die Resonanz: Ich erhielt fast 12.000 Impressions und über 300 Antworten. Und natürlich gab es auch viel Zustimmung zu meiner nicht geäußerten These, dass es ein Scheitern eigentlich nicht gibt, sondern dies eine Art Bedrohungsszenario ist, mit dem nicht zuletzt Veränderung verhindert wird. Scheitern geht nur in Bezug auf eine „Sache“, an der zumeist zwei oder mehr Menschen beteiligt sind. Es geht dabei viel um Kommunikation, denn Scheitern, so es denn unter den Antwortenden empfunden wurde, hat anscheinend viel mit unterschiedlichen Erwartungen an den jeweiligen Erfolg zu tun. Und ähnlich wie bei meiner Bekannten kamen auf die Frage „Was fällt euch als Erstes zum Scheitern ein?“ auch Antworten wie „Scham“, „Rückzug“ und „große Traurigkeit“. Und nicht selten wurde das Scheitern auch auf neue Jobs bezogen, wo im Vorstellungsgespräch anscheinend völlig aneinander vorbeigeredet wurde – obwohl sich beide Seiten im Anschluss entschlossen, einen Vertrag zu schließen.
Es scheint, trotz aller Terrabytes, die wir über New Work schreiben und reden, immer noch für sehr viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber nur schwarz oder weiß zu geben. Verhandlungen über grau sind tabu, weil jemand sich dann bewegen müsste.
Ist Scheitern wirklich negativ?
Zunächst: Der Duden weiß: „scheitern“ ist ein schwaches Verb. Wie passend. „Scheitern“ ist schließlich negativ in unserer Gesellschaft besetzt und damit zu vermeiden. Vor allem im beruflichen Kontext, der zumeist wahrnehmbarer ist als der private, fördert diese Einstellung den Stillstand. Das Verharren in Jobs, die schon lange nicht mehr passen. Manchmal sogar auf beiden Seiten. Arbeitgeber und Arbeitnehmer leben schließlich schon so lange zusammen, wie soll es ohne einander gehen? Klar, die Motivation ist lange nicht mehr so, wie sie am Anfang war. Auch die Kreativität, die Dinge anders anzugehen, leidet. Aber was sollen denn die anderen denken, wenn man hinschmeißt? Was sage ich der Familie? Ich habe doch so viele Verpflichtungen.
Unser System nährt Ängste, die sich real anfühlen und genährt werden, aber nicht auf realen Bedrohungsszenarien beruhen. Scheitern ist nicht sexy. Zumindest nicht für unser jetziges Berufsleben, das sich immer noch enorm an Status durch Organigramme, Titel und dicke Autos orientiert. Obwohl doch alle zu New Work Veranstaltungen, Meetups etc. gehen und Slack nutzen.
Wir lesen sie gerne, die Geschichten über Albert Einstein, Thomas Edison, Steve Jobs, die allesamt ziemlich deutlich während ihrer Leben gescheitert sind. Denn diesen Geschichten wohnt inne, da wir das Ende kennen, der Spoiler ist längst gesetzt: Alles wird (enorm) gut enden. Was den beruflichen Erfolg dieser Menschen über ihren Tod hinaus betrifft.
Der innere Angsthase
Was aber, wenn DEIN innerer Angsthase stärker ist als die innere Stimme, die sagt, ich mag da nicht mehr hin. Vielleicht, weil ich gelangweilt und unterfordert, drangsaliert von einem Vorgesetzten oder Kolleginnen oder aber mit der Entwicklung meines Unternehmens unzufrieden bin? Der Angsthase entgegnet bei vielen anscheinend: Jetzt zu gehen, wäre doch bescheuert. Da ist zum einen das Einkommen, die Sicherheit, die Familie, die Nachbarn – und außerdem habe ich doch auch investiert: In Lebenszeit und Nerven.
Auch ich kenne Ängste, die aus einer theoretischen Umgebung entstehen und sich sehr real anfühlen. Sie sind erstaunlich in einer Zeit, in der alles möglich zu sein scheint. Es gibt unendliche Optionen…., dann kommt die Schule und der Job. Beides hat mit Vorgaben und Konformismus zu tun. Wer damit leben und sich anpassen kann, der hat es leicht. Aber anpassen meint eben auch ausweichen, Entscheidungen nicht treffen. Sich hinter Ausreden zu verstecken.
Was bedeutet scheitern in einer Zeit, in der sich nicht zuletzt durch die Digitalisierung, aber auch viele andere Einflüsse die Geschwindigkeit und Themen nahezu täglich steigern? Liegt der Mangel an Wandel, der bei uns selbst beginnt, an der Überforderung durch die Außenwelt? Lässt uns diese in Jobs verharren lässt, die Sicherheit vorgaukeln? Selbst wenn „sicher“ in dem Moment nur bedeutet, dass ich weiß, wohin ich an meinen Werktagen gehen und was ich zu verrichten habe? Und was macht dieser Autopilot mit mir, wenn ich ihn hinterfrage? Lenkt er mich ins Meer und lässt meine bekannte Welt versinken?
Scheitern als Chance – auch eine Frage von unterschiedlichen Erwartungen
Meine persönliche Erfahrung
Ich war in meinem Berufsleben bereits zweimal in einer Situation, in der sich der Job wie eine schlechte Ehe anfühlte: Ich kannte mein Gegenüber sehr genau, wusste, wo Vor- und Nachteile lagen, hatte viel investiert und keine Fantasie, ob das Neue auch etwas Besseres wäre, weil ich nicht wusste, was das Neue sein sollte. Ich wusste nur, was das Alte nicht war. Ich versuchte erst mich, dann den Job zu ändern, aber das Gefühl blieb: Die besten Zeiten sind vorbei. Das erste Mal habe ich „klassisch“ über das Versenden von Bewerbungsunterlagen gelöst, beim zweiten Mal entschied ich mich, in die Offensive zu gehen und in allen sozialen Netzwerken zu platzieren, dass ich wieder zu haben bin. Ich warf mein Handy nach den Postings erstmal unter ganz viele Kissen auf meinem Sofa. Denn ja: ICH habe eine andere Haltung zu Neuaufbrüchen, aber haben die in Frage kommenden neuen Arbeitgeber diese auch!?
Gespannt auf das Ende meiner Geschichte? Ich arbeite seit dem 20. November (also anderthalb Monate nach dem Ende der letzten beruflichen Beziehung) in Teilzeit bei einem Traumarbeitgeber. Und genieße gerade #großeFerien, weil ich mir aushandelte, eine sechswöchige Pause zwischen den Jobs einlegen zu dürfen. Ich werde zudem meine Selbstständigkeit als Beraterin und Kommunikationsexpertin weiter auf- und ausbauen. Mein neuer Arbeitgeber kontaktierte mich aufgrund meines Tweets, der innerhalb von drei Wochen 40.000 Mal angesehen wurde. 90 Mal geteilt. Über 730 Mal wurde mein Twitterprofil, 600 Mal mein LinkedIn-Profil angeklickt. Ich hatte diverse Anrufe von Headhuntern, Personalerinnen und Projektpartnern. Es gibt Überlegungen zu Vorstandsposten im Ehrenamt, Aufträgen als Texterin und Moderatorin, Freitickets zu Veranstaltungen, um mich zu vernetzen mit Menschen, die ähnlich denken und arbeiten wie ich. Und es gab und gibt (bis heute!) jede Menge Direktnachrichten von Menschen, die sagen, dass sie wie ich feststecken, sich aber NICHT lösen können. Einige von ihnen habe ich sogar persönlich oder am Telefon gesprochen und ihnen Mut gemacht, das Alte hinter sich zu lassen. Und sei es erstmal in kleinen Schritten. Arbeitszeit verringern, Bildungsurlaub beantragen und etwas Neues beginnen.
Wir können gehen, ändern, anders denken
New Work ist in aller Munde und sicher ein Ziel, das sich anzustreben lohnt. Wie aber soll das funktionieren, wenn sich niemand verändert und von Altem trennt? Wie bekommen wir eine Kultur des Scheiterns und ein echtes Lernen aus Fehlern hin, wenn wir alle weiterhin unsere Masken hochhalten, weil es die Kollegin genauso macht? Ich plädiere nicht dafür, alles sofort fallenzulassen, was mal langweilt oder nervt. Machen wir mit unseren privaten Beziehungen ja hoffentlich auch nicht. Aber es lohnt sich, immer wieder mal etwas Abstand zwischen mir und den Job zu bringen und zu reflektieren, warum ich noch da bin. Toll, wenn es sich immer noch gut anfühlt. Nicht schlimm, wenn es nachhaltig schlechter wird. Denn wir sind nicht festgekettet. Wir können gehen, ändern, anders denken. Fangen wir damit an!

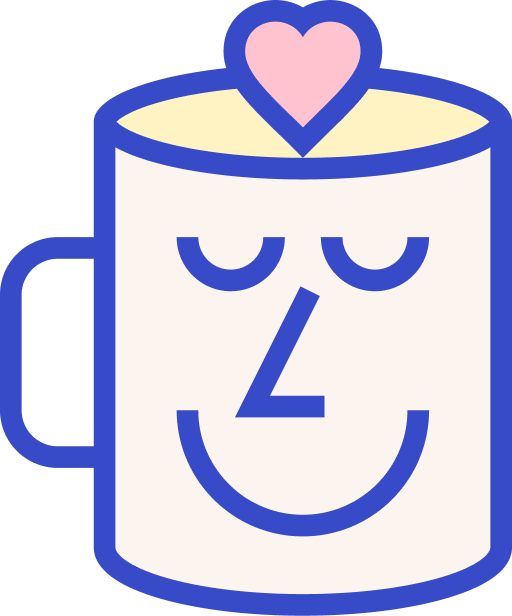
Schreibe einen Kommentar