Mobilität ist nicht geschlechtsneutral. Dies betrifft nicht nur die individuelle Mobilität, sondern auch den Verkehrs- und Planungssektor selbst, der stark von Männern dominiert ist (nur 22 Prozent aller Beschäftigten im Verkehrssektor sind weiblich). Gesellschaftliche Stereotype und die Rollenverteilung innerhalb einer überwiegend männlichen Belegschaft sowie die überwiegend von Frauen ausgeübte Care-Arbeit tun ihr Übriges, um ein auf männliche Bedürfnisse ausgerichtetes Umfeld zu schaffen.

Von Katja Diehl und Philipp Cern
Frauen leisten nach wie vor den größten Anteil an Care-Arbeit, das heißt, sie übernehmen mehr Verantwortung für die Organisation des Familienlebens. Dies geht in der Regel mit dem Transport von Einkäufen und Familienmitgliedern einher und führt zu sehr spezifischen Bedürfnissen hinsichtlich der Zugänglichkeit zur Verkehrsinfrastruktur. Trip-Chaining, die Kombination verschiedener Wege, ist typischer für Fahrten von Frauen als von Männern und findet näher am Wohnort statt und ist daher stärker von einer guten Fuß- und Radinfrastruktur abhängig.
Die Mobilität von Frauen ist weniger sichtbar, da ein beträchtlicher Teil ihrer Arbeit unbezahlt ist und daher nicht mit den klassischen Mitteln der Verkehrsdatenerfassung erfasst wird. Weibliche Mobilität ist zudem komplexer als die männliche; sie ist umso mehr auf ein funktionierendes multimodales Verkehrssystem angewiesen (53 Prozent der ÖPNV-Nutzer in Deutschland sind Frauen, weltweit liegt der Anteil sogar bei 66 Prozent). Ist ein funktionierendes multimodales Verkehrssystem nicht vorhanden, wird der Zweitwagen zur zweitbesten Option – auf Kosten der Umwelt.
Die typische Infrastruktur heutiger Städte ist um das Auto herum geplant. Der Zweite Weltkrieg hat Europa zerstört, der Wiederaufbau fand in einer Zeit statt, in der das Auto immer mehr an Bedeutung gewann. In den sechziger Jahren „passten“ die Städte nicht mehr zum Auto und ein Umdenken in der Stadtplanung wurde notwendig. Die Städte wurden von einer sehr homogenen Gruppe geplant und umgebaut: arbeitende Männer. Die europäischen Städte wurden größtenteils vor der Motorisierung gebaut, was bedeutete, dass mit der Ausbreitung der Automobilität, dem Platzbedarf und der zunehmenden Geschwindigkeit nicht nur die Bürgersteige klar von den Autostraßen getrennt werden, sondern auch den Autos viel mehr Raum gegeben werden musste.

Wir wachsen in Städten auf, die dem Auto einen exklusiven Raum geben, ihm wird erlaubt, schnell durch besiedelte Gebiete zu fahren – im Vergleich zur Geschwindigkeit aller anderen, die sich in der Stadt bewegen. Wir nehmen das als selbstverständlich hin, so wie man in einem Wald aufwächst und die Bäume als etwas Selbstverständliches wahrnimmt. Doch die Privilegien des Autos sind menschengemacht – und gehen auf Kosten der Vielen.
Selbst Crashtest-Dummys sind auf der Grundlage der männlichen Anatomie gebaut, wenn sie eingesetzt werden, sitzen die weiblichen Dummys auf dem Beifahrersitz. Das hat zur Folge, dass Frauen, die in einen Autounfall verwickelt sind, ein höheres Risiko haben, Verletzungen zu erleiden als ein Mann. Objektive und subjektive Sicherheitsbedürfnisse sind ein weiteres Problem für die weibliche Mobilität. Frauen sind gezwungen, sich in einem öffentlichen Raum zu bewegen, der für sie gefährlicher ist als für einen Mann im Auto, der in einer schützenden Metallhülle einfach und sicher hindurchfährt. Bei der Schneeräumung beispielsweise haben Straßen Vorrang, während das Unfallrisiko auf Rad- und Gehwegen höher ist.
Als mehrere schwedische Städte erstmals damit begannen, Geh- und Radwege zu räumen, ging die Zahl der Verletzten insgesamt zurück. Für Frauen liegt der Nutzen eines Mobilitätsmittels nicht nur darin, von A nach B zu kommen, sondern auch in der Gestaltung des öffentlichen Raums. Sie haben andere Sicherheitsbedürfnisse als Männer und müssen sich Strategien ausdenken, wie sie sich im öffentlichen Raum bewegen können, um sich weniger verletzlich zu fühlen. In den Medien und in öffentlichen Diskussionen haben es Frauen und marginalisierte Menschen schwer, mit ihren besonderen Bedürfnissen teilzunehmen oder gehört zu werden. Dies ist sicherlich ein Grund dafür, dass ihre Sicherheits- und Inklusionsbedürfnisse nicht ausreichend wahrgenommen werden.
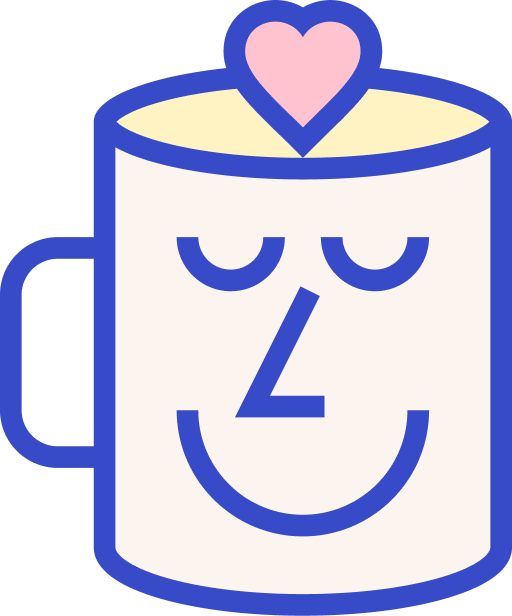
Schreibe einen Kommentar